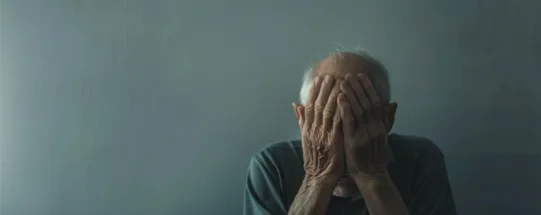Müssen Kinder für Eltern im Altersheim bezahlen?
Was sagt das Schweizer Recht zur Verwandtenunterstützungspflicht, wie regelt die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) die Berechnung der Unterstützung und unter welchen Umständen können Kinder tatsächlich finanziell zur Kasse gebeten werden.
Ein Überblick zur Situation in der Schweiz
Wenn Eltern ins Altersheim ziehen – wer bezahlt?
Ein Platz in einem Pflegeheim kann schnell zwischen 5’000 und 10’000 Franken pro Monat kosten – je nach Kanton, Einrichtung und Pflegestufe. Für viele Senioren reichen die AHV- oder IV-Renten, selbst in Kombination mit weiterem Einkommen, nicht aus, um die Pflegekosten zu decken.
Reichen die eigenen Mittel nicht aus, springt oft der Staat in Form von Ergänzungsleistungen (EL) oder Sozialhilfe ein. Doch die Behörden schauen genau hin – und prüfen im nächsten Schritt, ob Angehörige zur Unterstützung herangezogen werden können.
Die gesetzliche Grundlage: Artikel 328 ZGB
Im Zivilgesetzbuch (ZGB), Artikel 328, ist die sogenannte Verwandtenunterstützungspflicht geregelt. Sie verpflichtet:
- Kinder zur Unterstützung ihrer Eltern
- Eltern zur Unterstützung ihrer Kinder
- In Ausnahmefällen: Grosseltern, Enkelkinder, Geschwister
Diese Pflicht gilt aber nicht absolut – sie greift nur, wenn die unterstützungspflichtige Person in günstigen Verhältnissen lebt. Wer gerade so über die Runden kommt, wird nicht zur Kasse gebeten.
Was bedeutet „günstige Verhältnisse“?
Diese Formulierung wirft oft Fragen auf: Was genau bedeutet „günstige Verhältnisse“? Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) hat dazu konkrete Richtlinien veröffentlicht. Laut diesen lebt eine Person in günstigen Verhältnissen, wenn sie deutlich mehr als das zum Lebensunterhalt erforderliche Einkommen erzielt. Konkret gelten folgende Freibeträge:
- Ein verheiratetes Kind darf jährlich 120’000 Franken Bruttoeinkommen haben, ohne zur Unterstützung verpflichtet zu sein.
- Für Alleinstehende liegt dieser Schwellenwert bei 100’000 Franken.
- Zusätzlich gibt es einen Zuschlag pro Kind von etwa 10’000 Franken, um die Belastung fair zu berechnen.
Beispielhafte Berechnung:
Ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern darf also bis zu 140’000 Franken jährlich verdienen, ohne dass eine Unterstützungspflicht entsteht.
Zusätzlich bleiben folgende Kosten unangetastet:
- Berufsauslagen (z. B. Arbeitsweg, Kinderbetreuung)
- Krankenkassenprämien
- Rückstellungen für Altersvorsorge oder unerwartete Ausgaben
Berücksichtigung des Vermögens
Neben dem Einkommen spielt auch das Vermögen eine Rolle und wird durch die SKOS bei der Berechnung mitberücksichtigt. Dabei werden die folgenden Vermögen geprüft:
- Bankguthaben und Wertschriften
- Liegenschaften (auch Wohneigentum)
- Schenkungen oder Erbschaften
- Lebensversicherungen mit Rückkaufswert
Nicht angerechnet werden hingegen:
- Pensionskassenguthaben (sofern nicht bezogen)
- Bewegliches Hausinventar
- Persönliche Sammlungen (in der Regel)
Wird der Freibetrag von 250’000 bzw. 500’000 Franken überschritten, kann ein sogenannter Vermögensverzehr zur Finanzierung der Heimkosten verlangt werden. Bei grösseren Schenkungen innerhalb der letzten zehn Jahre kann die Behörde sogar Rückforderungen verlangen – auch bei den Kindern.
Was tun, wenn das Geld der Eltern nicht reicht?
Viele ältere Menschen sind trotz Renten und Sparguthaben nicht in der Lage, die Heimkosten langfristig zu decken. Dann greifen mehrere Instrumente. In der Praxis läuft es häufig so ab, dass die Gemeinde oder der Sozialdienst der betroffenen Person einspringt, wenn die Renten, das Einkommen oder das Vermögen nicht zur Deckung der Heim- oder Betreuungskosten reichen. Dies geschieht in Form von Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen (EL).
1. AHV/IV-Rente
Die Grundsicherung im Alter. Meist reicht sie allein nicht aus.
2. Ergänzungsleistungen (EL)
Sie helfen, wenn Renten und Einkommen zu niedrig sind. Voraussetzung: Ein Antrag bei der kantonalen Ausgleichskasse.
3. Hilflosenentschädigung
Diese Leistung wird zusätzlich zur IV oder AHV gezahlt, wenn jemand auf Hilfe bei alltäglichen Verrichtungen angewiesen ist.
4. Sozialhilfe
Als letzte Instanz tritt die Gemeinde mit Sozialhilfe ein. Die Behörden prüfen im Anschluss, ob Verwandte zur Unterstützung beigezogen werden können. In der Regel werden hierzu die finanziellen Verhältnisse der Kinder genau überprüft – inklusive Einkommen, Rente, Einkünfte, Wohneigentum und Schenkungen.
Wer wird zur Unterstützung herangezogen? Müssen Kinder für Eltern im Altersheim bezahlen?
Vor allem Kinder werden vorrangig geprüft. Gibt es mehrere Geschwister, wird die Summe anteilsmässig aufgeteilt. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe empfiehlt folgende Vorgehensweise:
Faktoren, die in die Beurteilung einfliessen:
- Anzahl Kinder
- Einkommen & Vermögen jedes Kindes
- Familiäre Verpflichtungen (eigene Kinder, Ehepartner)
- Berufliche oder gesundheitliche Situation
- Frühere Zuwendungen der Eltern (Schenkungen)
In Ausnahmefällen können auch andere Verwandte wie Geschwister, Schwiegerkinder oder Enkel in Betracht gezogen werden – allerdings ist das selten.
Beispiel aus dem Alltag
Die 82-jährige Mutter kommt ins Heim. Ihre monatlichen Kosten betragen 7’500 Franken. Ihre AHV-Rente liegt bei 2’300 Franken, sie hat kaum Ersparnisse. Die Gemeinde übernimmt den Fehlbetrag, prüft aber später die finanzielle Lage der Kinder:
- Sohn A lebt mit Familie, verdient 90’000 Franken → keine Beteiligung.
- Tochter B lebt allein, verdient 110’000 Franken → evtl. geringe Beteiligung.
- Sohn C lebt in gehobenen Verhältnissen, verdient 160’000 Franken, besitzt Wohneigentum → deutliche Beteiligung möglich.
Die Gemeinde entscheidet auf Grundlage der SKOS-Richtlinien, wobei auch individuelle Umstände berücksichtigt werden.
Was können Betroffene tun?
Tipps für Angehörige:
- Frühzeitig planen: Sprechen Sie offen mit Ihren Eltern über finanzielle Vorsorge, Vollmachten und Pflegewünsche.
- Schenkungen prüfen: Grosse Übertragungen an Kinder können später zurückgefordert werden – vor allem bei Eintritt ins Heim.
- Fachliche Beratung einholen: Anwältinnen, Sozialdienste oder die Pro Senectute bieten Unterstützung.
- Transparenz zeigen: Wenn die Gemeinde zur Auskunft auffordert, sollten Dokumente vollständig und korrekt eingereicht werden.
- Entscheid anfechten: Falls Sie sich zu Unrecht zur Zahlung verpflichtet fühlen, kann ein Rechtsmittelverfahren helfen.
Wichtig: Keine Existenzgefährdung
Die Verwandtenunterstützung soll nicht dazu führen, dass Kinder selbst in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Es darf also nur das zur Verfügung stehende Überschuss-Einkommen berücksichtigt werden. Der gesetzliche Selbstbehalt stellt sicher, dass der eigene Lebensunterhalt nicht gefährdet ist.
Eine geregelte, aber sensible Angelegenheit
Die Frage, ob Kinder für Eltern im Altersheim bezahlen müssen in der Schweiz, hängt von vielen Faktoren ab: Einkommen, Vermögen, Anzahl Geschwister, familiäre Verpflichtungen und rechtliche Details. Zwar existiert eine gesetzliche Unterstützungspflicht, doch sie greift erst ab klar definierten Einkommens- und Vermögensgrenzen.
Die SKOS-Richtlinien sorgen für Transparenz und Fairness, doch die konkrete Anwendung liegt oft im Ermessen der Gemeinde. Es lohnt sich, vorbereitet zu sein und frühzeitig gemeinsam mit den Eltern über mögliche Szenarien zu sprechen.
Rechtzeitig professionell beraten lassen
Sie möchten wissen, ob und in welchem Umfang Sie oder Ihre Geschwister zur finanziellen Unterstützung Ihrer Eltern verpflichtet wären? Dann holen Sie sich rechtzeitig professionelle Beratung – z. B. bei Ihrer Gemeinde, einer Sozialberatung oder einem Fachanwalt für Sozialversicherungsrecht. Je besser Sie informiert sind, desto gelassener können Sie schwierige Entscheidungen gemeinsam mit Ihrer Familie treffen. Teilen Sie diesen Artikel gern mit Freunden und Bekannten – denn Wissen schützt!